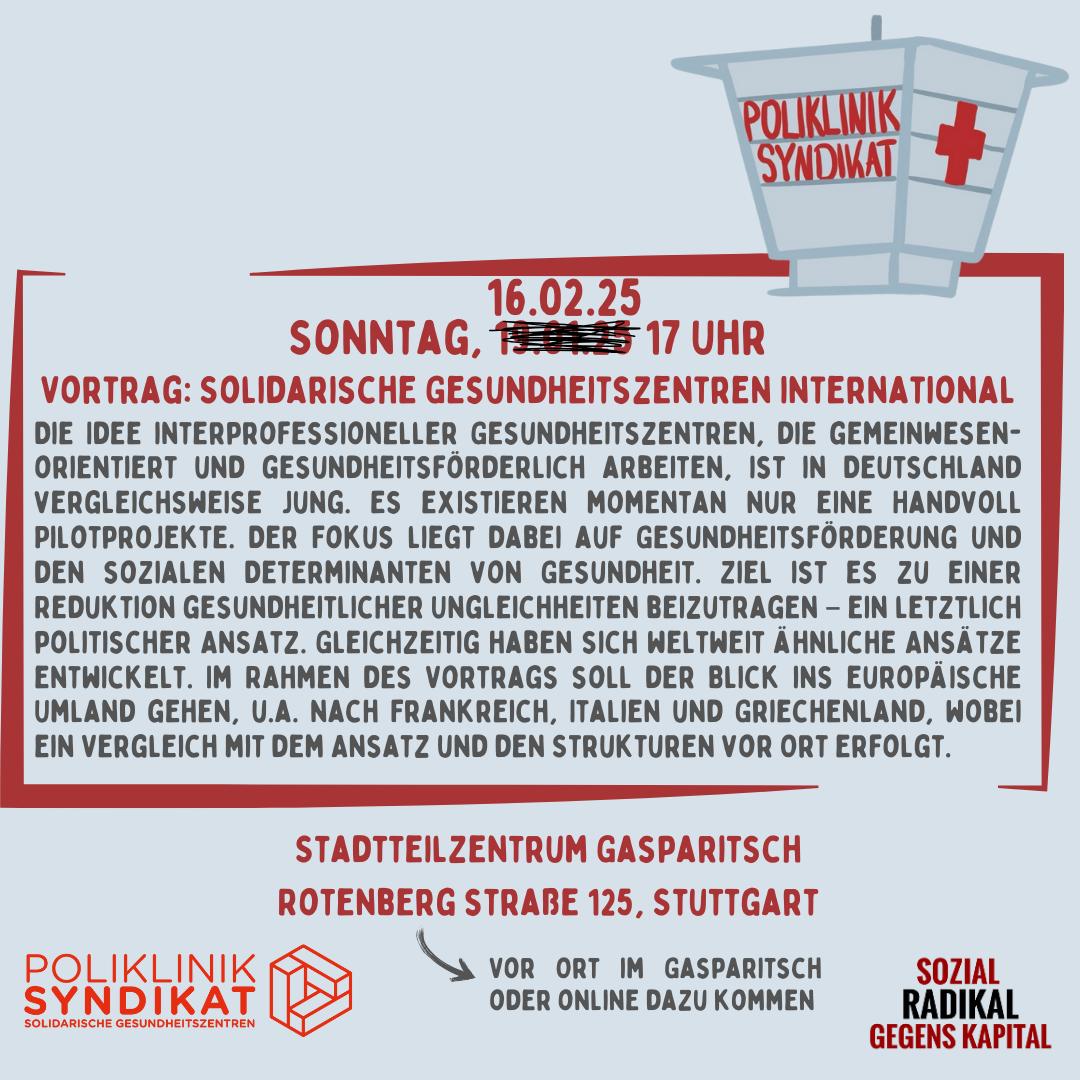So viele Nationalflaggen wie zu EM oder WM Zeiten, sind sonst kaum in der Öffentlichkeit zu sehen. Menschen hängen Nationalflaggen aus ihren Fenstern oder Autos, nehmen sie mit zum Public Viewing, bemalen ihr Gesicht damit oder schwenken sie beim Fanmarsch. Hauptmotiv dabei ist das Ausdrücken der Unterstützung der jeweiligen Fußballnationalmannschaft und der Zugehörigkeit zu einer (Fan-)Gruppe. Hinter dem Zeigen von Nationalflaggen im Fußballkontext muss also keine schlechte Absicht stehen, dennoch kann sich da-raus eine Gefahr und Dynamik entwickeln, auf die wir aufmerksam machen wollen.
Irene Götz, eine Professorin, die seit vielen Jahren zum Thema Nationalismus forscht, sagte in einem Interview im Tagesspiegel „Party-Patriotismus trägt zur Enttabuisierung von Nationalismus bei“. Diese Aussage trifft es auf den Punkt.
Auch ohne böswillige Absicht tragen die EM und die Einteilung in Nationen dazu bei, dass die ei-gene nationale Zugehörigkeit überhöht und andere abgewertet werden. Wenn von „den Türken“ oder „den Engländern“ gesprochen wird, ist unklar wer damit genau gemeint ist. Die Nationalmannschaft? Die Fans? Alle Menschen mit der jeweiligen Staatsangehörigkeit? Oder nur solche, die eine bestimmte Verhaltensweise zeigen? Sicherlich kann man argumentieren, dass solche Aussagen meist im Rahmen von Wut oder Freude über Ergebnisse und Ereignisse rund um die Fußballspiele getätigt werden und nicht sonderlich differenziert sein sollen/müssen, in etwa wie, wenn es heißt „schei* Schiri“. Allerdings schafft Sprache Bilder in unseren Köpfen. Wenn über Wochen hinweg von „den Türken“, „den Engländern“ oder „den Deutschen“ gesprochen wird, fördert das die sprachliche und gedankliche Vorstellung unterschiedlicher Gruppen und schafft eben Bilder über „die Anderen“. Nationalismus und die künstliche Trennung von Menschen wird so normalisiert.
Neben den nicht absichtlich nationalistischen Ausdrücken und Bildern, wird der Fußball und der eh schon bestehende Nationalbezug gezielt für rechte Botschaften genutzt. So gab es einen recht großen medialen Aufschrei als der türkische National-spieler Demiral bei einem Torjubel im Spiel gegen Österreich den Wolfsgruß zeigte.
→ Der sogenannte Wolfsgruß ist das Zeichen der „Grauen Wölfe“ oder „Ülkücü“ Anhänger. Dies ist eine rechtsextremistische Bewegung, deren Ideologie von Nationalismus, Rassismus, Sexismus, Antisemitismus und Queerfeindlichkeit dominiert wird. Das Ziel der Bewegung ist die Schaffung eines groß-türkischen Reichs. Sowohl in der Türkei als auch in Deutschland gehen von Anhängern der Grauen Wölfe massive Gewalt und Übergriffe aus.
Auch, wenn das Zeigen des Wolfsgruß durch Demiral der Beginn der medialen Aufmerksamkeit war, war dies nicht das erste Mal während der EM. Bereits davor wurde der Wolfsgruß bei Fanfeiern gezeigt. Außerdem gab es mehrere Vorfälle in denen Menschen mit kurdischer Flagge von Menschen mit türkischen Flaggen angegriffen wurden.
Nach dem Vorfall mit dem Spieler Demiral, gab es durch „Turkish Ultras“ einen Aufruf, den Wolfsgruß beim Viertelfinale zu zeigen, dem einige Fans nachkamen. Für alle Menschen, die sich nicht erst seit der EM mit türkischem Faschismus und der Ülkücü-Bewegung beschäftigen, war das nicht sonderlich überraschend. Irritierend war eher, dass es so einen großen medialen Aufschrei gab. Nicht, weil dieser nicht angemessen war, sondern weil sich die deutschen Medien und Politik sonst recht wenig dafür interessieren. So setzt die deutsche Politik schon lange mehr auf die Bekämpfung emanzipatorischer kurdischer Bewegungen und kriminalisiert diese (viele kurdische Aktivist*innen sind mit massiven Repressionen konfrontiert, kurdische Proteste werden genauestens beobachtet und die „PKK“ als vermeintliche Terrororganisation verboten) als auf die Bekämpfung von türkischem Faschismus. Die Ülkücü-Bewegung wird zwar vom Verfassungsschutz beobachtet, der Wolfsgruß ist aber anders als in Österreich und Frankreich nicht verboten.
In Berlin wurde der türkische Fanmarsch wegen dem mehrfachen Zeigen des Wolfsgruß unter- und abgebrochen. Politische Botschaften seien bei einem Fanmarsch nicht erlaubt, so die Polizei. Die UEFA sperrte Demiral für zwei Spiele nach dem Zeigen des Wolfsgruß für die Nichteinhaltung allgemeiner Verhaltensgrundsätze und dem Nutzen von Sportereignissen für Kundgebungen nicht-sportlicher Art.
So wird eine politische (rechte) Geste zwar sanktioniert, aber trotzdem nicht eingeordnet, sondern entpolitisiert. Auch schlossen sich viele Kommentare in den Medien der Aussage an, dass der Wolfsgruß natürlich nicht in Ordnung sei, aber vor allem die EM und Fußball kein Platz für politische Ausein-andersetzungen sei.
Wir fragen uns, wie kann Fußball überhaupt unpolitisch sein?
Überall wo Menschen zusammenkommen ist ein politischer Raum. Besonders, wenn es um Nationen, also politische Konstrukte, geht und politische Staatsoberhäupter unter großem Tamtam die Spiele besuchen. Der scheinbar unpolitische Raum wird von rechten Akteuren genutzt. So waren „Stop the boats“ Banner von englischen Fans zu sehen, „Defend Europe“ Flaggen von österreichischen und tschechischen Fans, in Dortmund wurde von italienischen Fans der Hitlergruß gezeigt, rumänische Hools posierten mit „Bucharest against Antifa“ und ausgehend von albanischen und kroatischen Fans gab es Gesänge mit „Tötet Serben“. Das ist nur eine kleine Auswahl an Vorfällen rund um die EM, über die es wenig Berichtserstattung gab. Ist das dieser unpolitische Raum? In einigen Fällen reagierte die UEFA mit dem Sperren von Spielern und Geldstrafen für Fußballverbände, trotzdem wird kaum darüber gesprochen. Bekämpft man so die extreme Rechte, Nationalismus und Faschismus? Die nationalistischen Auswüchse der EM und das Nichtthematisieren, Tabuisieren und Entpolitisieren haben reale Auswirkungen auf Menschen. Wie sicher können sich kurdische oder alevitische Menschen fühlen, wenn Fanmärsche mit Wolfsgrüßen durch die Straßen ziehen? Wie sicher können sich geflüchtete Menschen fühlen, wenn sie an Fans mit „Stop the boats“ und „Defend Europe“ Bannern vorbei laufen? Wie sicher können sich jüdische Menschen fühlen, wenn in den Straßen Hitlergrüße gezeigt werden? Wie sicher können sich Antifaschist*innen fühlen, wenn es „Bucharest against Antifa“ heißt? Wie sicher können sich migrantisierte Menschen fühlen, wenn Gesänge wie „Ausländer raus“ ertönen und nazistische Tattoos und Zeichen offen gezeigt werden? Wie sicher können sich serbische Menschen im Stadion fühlen, wenn neben ihnen „tötet Serben“ gerufen wird?
Orte, die eben durch den starken Nationalbezug, ein Anknüpfungspunkt für rechte und extrem rechte Akteure darstellen, dürfen nicht entpolitisiert werden, denn das macht sie nicht unpolitisch, sondern verschleiert rechte Einflüsse, verkennt die Gefahr für Betroffene und normalisiert rechte Botschaften.
Wir sehen, dass Fußball und die Freude über den Sieg der favorisierten Mannschaft verbindend sein kann, sowohl innerhalb der eigenen Fangruppe, als auch darüber hinaus. Auch wir haben die Bilder von zusammen feiernden Fans gesehen, die nicht derselben Mannschaft anhängen. Wir haben aber auch die Bilder gesehen wie „gegnerische“ Fans aufeinander losgehen, sich prügeln, wie Stereotype und Vorurteile wiederholt werden und Feindbilder gezeichnet werden.
Irene Götz sagt dazu passenderweise: „Fußball ist nicht der Auslöser, aber er ist etwas, was diese Normalisierung des Umgangs mit dem Nationalen und auch den Missbrauch vorantreiben kann.“
Wir wollen nicht leugnen, dass das Gefühl von nationaler Zugehörigkeit Sicherheit bieten und Identität stiften kann. Allerdings ist es immer zugleich eine Abgrenzung gegenüber anderen, die Anknüpfungspunkte für Abwertung, Nationalismus und rechte Narrative bietet.
Wer Nationalflaggen schwenkt, sich aber nicht mit Nationalismus auseinandersetzen möchte, bietet genau diesem ein Einfallstor!